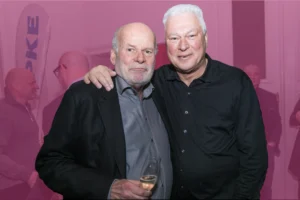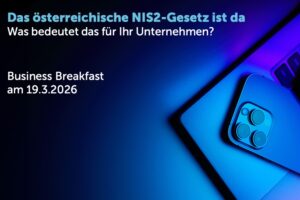Altersvorsorge für selbstständige Frauen in Österreich – Teil 1

Warum gerade selbstständige Frauen besonders vorsorgen müssen
Für viele Unternehmerinnen sind Freiheit, Selbstbestimmung und die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen, wichtige Motive den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen. Freiheit hat nicht nur Vorteile, sondern sie kann auch ihre Schattenseiten haben. Insbesondere die Altersvorsorge bleibt lange ein blinder Fleck in der Berufsbiografie von Unternehmerinnen. Das betrifft aber nicht nur Frauen, auch viele selbständige Männer schieben das Thema gerne vor sich her.
Während Angestellte automatisch in der Pensionsversicherung abgesichert sind und zudem oft noch von betrieblichen Vorsorgeleistungen profitieren, tragen Selbstständige einen Teil der Verantwortung für ihre Absicherung selbst. Für Frauen im Allgemeinen kommt erschwerend hinzu, dass sie in Österreich nach wie vor mit besonderen Herausforderungen wie Einkommenslücken, Kinderbetreuung und der sogenannten Teilzeitfalle konfrontiert sind.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Frauen beziehen in Österreich im Schnitt deutlich niedrigere Pensionen als Männer – rund 40 % weniger. Besonders stark betroffen sind Frauen, die in ihrem Erwerbsleben unterbrochene Versicherungszeiten, geringere Einkünfte oder lange Phasen in Teilzeit hatten. Selbstständige Frauen laufen damit doppelt Gefahr: Sie müssen nicht nur selbst für ihre Vorsorge sorgen, sondern auch strukturelle Nachteile ausgleichen, die bereits während des Erwerbslebens entstehen.
Grundsätzlich gilt für alle Berufstätigen: Je früher Sie sich mit Ihrer Altersvorsorge beschäftigen, desto besser können Sie die Weichen stellen.
Besondere Herausforderungen für Selbstständige
Während Angestellte von einem gewissen „Automatismus“ profitieren – die Sozialversicherungsbeiträge werden direkt vom Lohn abgezogen, Arbeitgeber leisten Beiträge, betriebliche Vorsorge ist teilweise vorgesehen – ist die Situation für Selbstständige komplizierter.
- Unregelmäßige Einkommen
Viele Selbstständige, insbesondere in kreativen Berufen, im Dienstleistungssektor oder im Handel, haben schwankende Einnahmen. Mal läuft das Geschäft sehr gut, mal ist es schwierig. Diese Unregelmäßigkeit wirkt sich unmittelbar auf die Beitragszahlungen zur Sozialversicherung und damit auf die künftige Pension aus.
- Fehlende Arbeitgeberbeiträge
Selbstständige müssen die gesamten Sozialversicherungsbeiträge selbst tragen. Es gibt keinen Arbeitgeber, der einen Teil übernimmt. Das bedeutet höhere Belastung während des Erwerbslebens – und oft die Versuchung, Beiträge zu minimieren, was später zu niedrigeren Pensionen führt.
- Weniger Zugang zu betrieblichen Vorsorgemodellen
Während Angestellte mit Betriebszugehörigkeit in manchen Branchen von Zusatzpensionen profitieren, fehlt Selbstständigen diese Möglichkeit meist. Sie müssen bewusst nach Alternativen suchen, etwa über Pensionskassen für Selbstständige oder private Vorsorgeprodukte. - Höheres Risiko von Erwerbslücken
Krankheit, Auftragsmangel oder Phasen der Kindererziehung führen bei Selbstständigen schneller zu Beitragslücken. Anders als bei Angestellten gibt es keinen Kündigungsschutz, keine Karenzvereinbarungen und keine bezahlten Auszeiten.
Die Pensionsversicherung für Selbstständige (SVS)
In Österreich sind Selbstständige grundsätzlich über die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) pflichtversichert. Die Beiträge umfassen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung.
Beitragsgrundlage: Die Höhe der Pensionsversicherungsbeiträge richtet sich nach dem Einkommen. Es gibt eine Mindestbeitragsgrundlage, die auch dann gilt, wenn das Einkommen sehr niedrig ist.
Pensionsberechnung: Wie bei Angestellten erfolgt die Berechnung nach dem lebenslangen Durchschnitt der Beitragsgrundlagen. Jede Beitragslücke senkt die künftige Pension.
Kindererziehungszeiten: Auch für Selbstständige werden pro Kind bis zu 4 Jahre (bzw. 5 bei Mehrlingen) als Versicherungszeiten angerechnet – allerdings auf Basis einer fiktiven Beitragsgrundlage.
Ein wesentlicher Unterschied: Selbstständige tragen das volle Risiko. Wer krank wird oder eine Zeit lang keine Aufträge hat, zahlt weniger oder gar nicht ein – und das wirkt sich unmittelbar aus.
Kindererziehung und Altersvorsorge
Gerade für Frauen ist die Kindererziehung ein zentraler Faktor, der über die spätere Pension entscheidet. In Österreich werden Kindererziehungszeiten zwar angerechnet, aber sie gleichen nicht vollständig aus, was durch fehlendes Einkommen verloren geht. Anrechnung: Pro Kind bis zu 48 Monate, unabhängig von einer Erwerbstätigkeit.
Fiktive Beitragsgrundlage
Die Anrechnung erfolgt auf Basis eines fixen Betrags, nicht auf Basis des tatsächlichen Einkommens. Das bedeutet: Wer vorher ein hohes Einkommen hatte, verliert trotzdem Pensionsansprüche.
Pensionssplitting
Eltern können entscheiden, ob ein Teil der Pensionsgutschrift des erwerbstätigen Elternteils an den betreuenden Elternteil übertragen wird. Gerade für Selbstständige ist das eine wichtige Möglichkeit, Einkommenslücken abzufedern.
Die Praxis zeigt allerdings: Viele Paare nutzen das Pensionssplitting nicht – sei es aus Unkenntnis oder weil die Beantragung kompliziert erscheint. Für selbstständige Frauen bedeutet das, dass sie umso stärker auf private Vorsorge achten müssen, wenn sie in den ersten Jahren nach einer Geburt weniger arbeiten können.
Die Teilzeitfalle in der Selbstständigkeit
Auch in der Selbstständigkeit gibt es eine Art „Teilzeitfalle“. Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit oder nehmen nur kleine Aufträge an, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Das klingt flexibel und praktisch – hat aber langfristig massive Folgen: Weniger Einkommen = weniger Beiträge. Schon wenige Jahre mit deutlich reduziertem Einkommen können die Durchschnittsberechnung der Pension erheblich nach unten ziehen.
Längere Erwerbspausen
Anders als bei Angestellten gibt es keine fixen Karenzmodelle. Die Karenzzeit muss jedoch mindestens zwei Monate betragen. Wer in der Selbstständigkeit dann eine Pause macht, riskiert echte Beitragslücken.
Kombination mit Care-Arbeit
Viele selbstständige Frauen übernehmen neben ihrem Unternehmen noch den Großteil der unbezahlten Familienarbeit. Das bedeutet weniger Zeit für bezahlte Arbeit – und damit weniger finanzielle Mittel für Vorsorge.
Aufholen in der Praxis oft kritisch
Besonders kritisch: Viele Selbstständige denken, dass sie „später schon aufholen“ können, wenn die Kinder größer sind. Doch die Praxis zeigt, dass diese Lücken kaum noch vollständig kompensiert werden können.
Hinweis: Alle Angaben in diesem Beitrag sind ohne Gewähr und diese können sich auch ändern. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte zum Beispiel an Ihre Steuerberater:in des Vertrauens, an professionelle Finanzberater:innen oder an die Wirtschaftskammer.