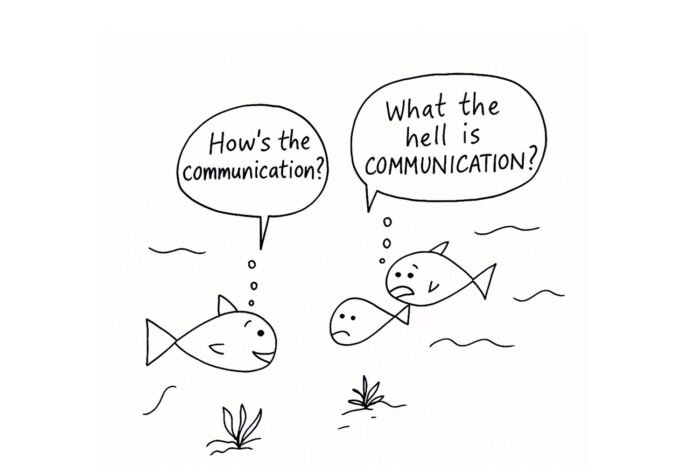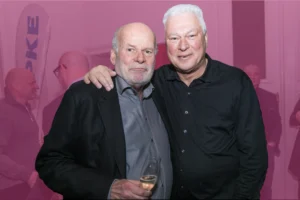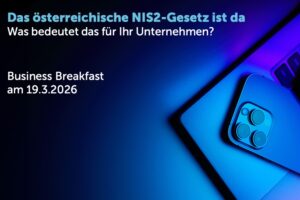Krebsdiagnose: Lungenkrebs und Gehirntumore führen zu den stärksten Einschnitten in der Erwerbsbiografie

Jährlich erhalten in Österreich rund 15 000 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren eine Krebsdiagnose, 8 500 davon, während sie im Berufsleben stehen. Lungenkrebs und Gehirntumore führen laut einer Analyse von Statistik Austria zu den stärksten Einschnitten in der Erwerbstätigkeit.
„Ob und in welchem Umfang Betroffene nach einer Krebsdiagnose erwerbstätig bleiben oder wieder werden, hängt auch maßgeblich von der Art des Tumors ab. Personen mit Gehirntumoren zeigen in allen Altersgruppen starke Einschnitte in der Erwerbsbeteiligung. Bei Erkrankten über 30 Jahren führt Lungenkrebs zu den stärksten Einschränkungen in der Erwerbstätigkeit. Über alle Tumorlokalisationen hinweg sind zwei Jahre nach einer Krebsdiagnose 77 % der Betroffenen weiterhin oder wieder berufstätig – im Vergleich zu 89 % in der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung“ , so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.
Starke Unterschiede in Erwerbsbeteiligung je nach Tumorart bereits bei Diagnosestellung
Es zeigt sich, dass die Erwerbsbeteiligung bereits bei Diagnosestellung je nach Tumorlokalisation stark variiert. Sie ist beispielsweise bei malignen Melanomen und bei Schilddrüsenkrebs hoch (rund 70 %), jedoch bei Leber- und Lungenkrebs niedrig (30 % bzw. 40 %). Das bedeutet, dass von allen Personen, die im Alter zwischen 15 und 64 Jahren eine Lungenkrebsdiagnose erhalten, nur 40 % zum Zeitpunkt der Diagnosestellung erwerbstätig sind. Die niedrige Erwerbsbeteiligung bei Leber- und Lungenkrebs spiegelt bereits in der Literatur beschriebene strukturelle soziale und gesundheitliche Benachteiligungen wider, die oft schon Jahre vor der Diagnose bestehen.
Relative Erwerbswahrscheinlichkeit 2 Jahre nach Krebsdiagnose stark abhängig von Tumorart
Um die Auswirkungen einer Krebsdiagnose auf die Erwerbsbeteiligung der Betroffenen zu bestimmen, wurde für die Analysen das Konzept der relativen Erwerbswahrscheinlichkeit (REW) entwickelt. Dieses stellt das Verhältnis des Anteils der Erwerbstätigen unter den Krebserkrankten zum Anteil der gleichaltrigen Erwerbstätigen in der Gesamtbevölkerung dar. Insgesamt liegt die relative Erwerbswahrscheinlichkeit von Personen mit einer Krebserkrankung bei knapp über 86 % –2 Jahre nach ihrer Krebsdiagnose sind Personen also mit einer um rund 14 % geringeren Wahrscheinlichkeit erwerbstätig als die gleichaltrige Gesamtbevölkerung.
Unterscheide Frauen und Männer
Maligne Melanome und Schilddrüsenkrebs zeigen mit einer relativen Erwerbswahrscheinlichkeit von jeweils rund 100 % nahezu keine Einschränkung der Erwerbstätigkeit 2 Jahre nach Diagnose – das heißt, die Erwerbswahrscheinlichkeit von Personen mit einer dieser Diagnosen ist fast genauso hoch wie die der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung. Nierenkrebs weist eine relative Erwerbswahrscheinlichkeit von 91 % auf. Rund 80 % beträgt sie bei Personen mit Blutkrebs – darunter Leukämie, Lymphome oder multiples Myelom – sowie bei Krebs im Magen-Darm-Trakt und mit Gehirntumoren. Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich sowie Lungenkrebs führen zu den stärksten Einschränkungen der Erwerbstätigkeit mit relativen Erwerbswahrscheinlichkeiten von 70 % bzw. 61 %.Bei Männern mit Prostatakrebs liegt die relative Erwerbswahrscheinlichkeit nach 2 Jahren bei 84 %, bei Frauen mit Brust- oder Gebärmutterkrebs liegt sie bei rund 90 % und mit Eierstockkrebs bei 79 %. Bei Blasenkrebs, Gehirntumoren und hämatologischen Neoplasien sind Frauen stärker in der Erwerbstätigkeit eingeschränkt als Männer. Bei anderen Tumorlokalisationen haben Frauen einen Erwerbsvorteil gegenüber Männern.
Quelle: statistik.at